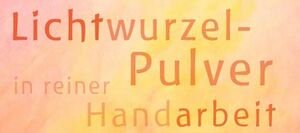Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Sprachgestaltung mit Wolfgang Peter - Einführung in Grundübungen, 2025
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9

Überblick
Am Ostermontag, dem 21. April 2025, gab Dr. Wolfgang Peter in Perchtoldsdorf bei Wien/Ö. eine Einführung in die Grundübungen der Sprachgestaltung. Mit dabei waren Margherita, Elke und François.
Transkription des Vortrages Sprachgestaltung mit Wolfgang Peter vom 21. April 2025
Einführende Worte zur Sprachgestaltung: Vom Erleben jedes Lautes 00:00:28
Ja, also ich begrüße euch ganz herzlich, ich möchte euch heute gemeinsam mit meinen Partnerinnen hier, den Sprachgestaltungspartnerinnen, einen Überblick geben über das Wesen der Sprachgestaltung, über das Wesen der Laute in der Sprache. Und wir arbeiten mit den Übungssprüchen, die Dr. Karl Rössel-Majdan verfasst hat, mit denen ich selbst vor 40 Jahren begonnen habe zu arbeiten. Und das Wesentliche, um das es geht, ist in das Erleben jedes Lautes einzudringen.
Vokale A und E: Beim A öffne ich mich nach außen, beim E grenze ich mich ab 00:01:05
Typisch ist einmal, die Vokale geben also etwas wieder, was die Seelenstimmung zum Ausdruck bringt. Man kann also das Seelische sehr gut, gerade durch die Vokale, wenn man sie schön zum Klingen bringt oder auch in Verzweiflung zum Klingen bringt, wie auch immer, kann man sehr gut die Seelenstimmung zum Ausdruck bringen. Und wir werden auch sehen, wie jeder einzelne Vokal eine ganz bestimmte Grundstimmung auch hat, die sich sehr variieren lässt, aber doch eine charakteristische Grundstimmung ist.
Also, um ein Beispiel zu geben, im A, wenn ich großes A mache, dann ist es ein Aufgehen, ein Sichöffnen. Es ist sicher nicht irgend so etwas. Da geht es auf, es ist ein Erstaunen drinnen auch. Also ein ganz, sich naiv der Welt hingeben, sich selbst ganz vergessen und an die Welt hingegeben zu sein. Das ist so die Grundstimmung, die drinnen ist. Ganz im Gegensatz zum E, E, E. Wenn ich E mache - ich mache es jetzt bewusst sehr scharf - das ist der Grundcharakter, im Deutschen der häufigste Vokal, absolut unsympathisch von der Grundstimmung her. Zähneblecken, die bringen hier den Klang hervor, wenn ich die Zähne als Sperre hinstelle. Das heißt, ich grenze mich ab. Bin dafür aber viel mehr bei mir selbst. Wenn ich es in eine Geste ausdrücken will, dann ist es zum Beispiel so eine Geste. Ich halte mich an mir selbst an, ich spüre mich. Viel weniger die Außenwelt. Im A vergesse ich mich und bin draußen. Im E bin ich bei mir.
Menschen und Tiere nehmen ihre Umgebung unterschiedlich wahr. Als einziges Lebewesen kann der Mensch einen bestimmten Punkt oder sich selbst fokussieren 00:02:50
Das ist sogar etwas ganz Markantes im Bau des Menschen, dass wir ständig überall in unserem Organismus, aber auch in unserer Sinnestätigkeit diese Überkreuzungen haben. Man nehme nur die bewusste räumliche Wahrnehmung. Ein Auge, zweites Auge. Nur wenn ich da fokussieren kann, nehme ich die Welt überhaupt räumlich wahr. Ein Pferd zum Beispiel, obwohl es sich sicher im Gelände bewegt, sieht die Welt nicht räumlich. Ein Auge schaut mehr oder minder dahin, das andere dorthin, die Überlappung ist ganz gering. Das heißt, kaum ein Erlebnis für den Raum. Und trotzdem, das Pferd spürt es, es spürt es am Boden. Aber nicht durch die optische Orientierung. Und wenn da jetzt irgendetwas kommt, kann auch weit entfernt sein oder nah sein, es hat keine Einschätzung für Distanz - es scheut. Wir können das abschätzen. Die Gefahr ist eh noch 300 Meter entfernt, da muss ich noch nicht gleich davonlaufen. Das Pferd nimmt das nicht wahr. Irgendetwas huscht vorbei und - wuuhh - schreit vielleicht.
Und auch mit den Ohren fokussiert es nicht so genau wie bei Katzen zum Beispiel oder Raubtiere. Raubtiere fokussieren zumindest mit den Ohren. Mit den Augen auch nicht so, aber mit den Ohren fokussieren sie. Da spüren sie genau, wo kommt das her. Beim Pferd ist es auch mit den Ohren mehr zur Seite irgendwo, so ein Allgemein-Geräusch. Egal ob nah oder fern - es scheut. Mir ist das einmal passiert, wie ich reiten gelernt habe, als junger Mensch. Da sind wir halt schön ta-tum-ta-tum dahin … und neben der Eisenbahnstrecke. Und dann fährt die blöde Eisenbahn - Verzeihung! - und macht Tüt! Und das Pferd macht Wuuuh. Und ich bin hinten gelegen auf dem Kiesel, auf den spitzen Kiesel gefallen mit dem Rücken. Da habe ich ausgeschaut, als hätte man mich ausgepeitscht. Meine Mutter hat dann nachher die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
Aber das passiert halt. Das heißt, Fluchttiere können das nicht so räumlich fokussieren. Wir haben ganz stark, als stärkstes von allen Lebewesen auf Erden haben wir dieses Sich-Fokussieren-Können auf einen bestimmten Blickpunkt, oder eben dadurch zugleich auch sich auf sich selbst fokussieren. Dadurch haben wir das Erlebnis, ich bin da - und die Welt ist dort, dort, dort in einer bestimmten Entfernung oder Nähe. Wir können uns trennen. Die Tiere im Wesentlichen können sich nicht trennen. Sie sind im Erleben eins mit dem Ganzen. Kann man sich so schwer vorstellen, wie anders selbst eine Katze, selbst Raubtiere, anders die Welt erleben als wir. Die Katze hat dann zum Beispiel, wenn sie Hunger hat, also wirklich auf Beutefang aus ist, dann ist sie ganz eng fokussiert auf die Maus zum Beispiel, die da sitzt. Was links und rechts ist, nimmt sie überhaupt nicht wahr. Aber die kleine Bewegung der Maus, das ist so ein enger Kanal. Wir können ein großes Panorama überschauen, im Gleichmaß irgendwo.
Über die Vokale wird Seelenstimmung und Emotion transportiert, die Konsonanten geben Formen 00:06:21
Und das liegt im E-Charakter drinnen. Und natürlich, man kann ihn auch warm sprechen. Klar, ich kann auch sympathisch sprechen. Also ich kann zum Beispiel, wenn wir ein Übungssprücherl machen:
„Dem strebt entgegen E.
Erkennt der Mensch den Menschen je.
Des Evchens Welt, er enger seh.
Es lebt dem E.“
Also man kann es auch versuchen ins Warme zu bringen. Man kann es mit jedem umfärben natürlich. Aber der Grundcharakter ist streng, sehr streng. Und das heißt, es kann auch eine Übung sein, um auch die strenge Sprache zu üben, die man auf der Bühne braucht, im Leben auch manchmal irgendwo. Manchmal geht's nicht mit der Sanftheit, manchmal muss man sagen Stopp, Ende. Dann muss auch eine gewisse Kraft, Energie drinnen liegen.
Es liegt also da im E viel Energie drinnen. Das ist also die Seelenstimmung eigentlich, die drinnen ist, die Emotion, die drinnen ist, die wird vor allem über die Vokale transportiert. Die Konsonanten geben Formen. Es fängt an, eigentlich noch fast umgeformt beim H, beim H, Hauch. Das ist fast nur ausgeatmete Luft. Daraus sieht man aber schon eines, der Konsonant zieht Atemluft nach außen. Da muss ich auch wirklich Atemluft einsetzen. Und unter Umständen ist eine einzige Silbe, die vielleicht einen Vokal in der Mitte hat und durch zwei Konsonanten eingewärmt ist, wenn ich sie eindringlich machen will, muss ich es nicht unbedingt laut machen, aber dann ist in dieser einen Silbe mit Konsonant vorne, Konsonant hinten, Vokal in der Mitte, ist ein ganzer Atemzug unter Umständen weg. Und ohne dass ich es laut spreche, ist aber immense Intensität drinnen, einfach Kraft drinnen, die spürbar wird.
Die Sprachgestaltung enthält sehr viel seelischen und geistigen Inhalt, aber das Werkzeug dazu ist der Körper. Klang entsteht durch die Atemkraft 00:08:27
Das heißt also, es ist wichtig, die Atmung wirklich voll betätigen zu können und es selber im Bewusstsein zu haben, wie stark will ich einsteigen, wie wenig will ich einsteigen. Es ist beides möglich, aber es soll nicht einfach - wie soll ich sagen - dem Zufall oder der Gewohnheit unterliegen, sondern Sinn der Sprachgestaltung ist auch ganz bewusst dabei zu werden, wie spreche ich, sich selbst zuhören zu können, selbst fühlen zu können, wie viel Atemluft setze ich ein, wie wirkt sich das auf meine Körperhaltung aus? Die spielt eine ganz wesentliche Rolle. Die Grundhaltung ist die aufrechte Haltung. Ich hoffe, das geht sich jetzt mit der Kamera aus, dass ich aufstehe dabei. Dass man also wirklich aufrecht steht, vielleicht ein bisschen Standbein, Spielbein … also nicht so wie Habt Acht! stehen, weil da kommt man nicht in Bewegung, da steht man wie eine Säule. Sondern typische Haltung, Grundhaltung, Standbein, Spielbein, aus der kann man sofort in die Aktion gehen und das ist ganz wichtig. Aber wenn man zum Beispiel so irgendwie lässig steht, sich hängen lässt, fängt das an, den ganzen Resonanzraum zu dämpfen und der Klang wird dann nicht mehr so voll, nicht mehr voll des Seelischen, das eigentlich drinnen lebt, sondern es wird mehr äußerlich.
Also das heißt, weil der Klang soll nicht entstehen dadurch, dass ich jetzt besonders viel Druck da auf die Stimmbänder drauf gebe. Da soll eigentlich überhaupt kein Druck drauf sein. Sondern es entsteht durch die Atemkraft. Der Atem trägt das und der Klang entsteht durch die Resonanz, entweder im Brustbereich, da im Körperbereich oder oben. Wenn ich sage „hell, helles Licht” dann klingt da oben etwas, dann klingt die sogenannte Maske, die Knochen da mit, die schwingern, die tragen es. Also niemals der Kehlkopf. Der soll eigentlich nur ganz entspannt dirigieren, dann kann man wirklich stundenlang sprechen und die Stimmbänder sind nicht angestrengt. Also wenn man merkt, ähh - jetzt habe ich da drei Sätze gesprochen und bin schon heißer, weil ich es ein bisschen lauter für das Publikum sprechen sollte, dann ist es typisch das Zeichen dafür, dass ich zu viel herausquetschen tue aus den Stimmbändern und zu wenig Körperresonanz habe. Also die Körperresonanz ist ganz wichtig. Das ist überhaupt, also wenn man nimmt Sprachgestaltung … wir werden sehen, dass da sehr viel seelischer und geistiger Inhalt ist, aber das Werkzeug dazu ist beinhart der Körper. Und das heißt, es ist eigentlich die Sprache und dann besonders das Schauspiel etwas sehr, sehr Körperbetontes. Da muss der Körper funktionieren und mir folgen, meinem Willen wirklich folgen. Und nicht so, wie ich es halt aus meiner Gewohnheit habe.
Menschen am Gang und am Schritt erkennen 00:11:34
Das geht so weit im Schauspiel, dass wenn man eine Rolle beginnt einzustudieren, mit der Zeit lernt man sie kennen, man lernt den Charakter der Rolle kennen, es ändert sich die Art, wie man spricht und es ändert sich vor allem auch der Gang, der Schritt ändert sich. Ihr werdet das vielleicht kennen, wenn im Stiegenhaus jemand die Treppe hinauf geht, man erkennt den Menschen am Schritt. Man weiß, wer es ist. Nicht nur irgendwer geht durch. Aha, ja, das ist der oder der!
Nein, den kenne ich nicht. Wer will da was im Haus? Wie kommt der herein? Man erkennt es sofort, ob es ein bekannter Schritt ist oder ein unbekannter. Man könnte es vielleicht gar nicht in Worte ausdrücken, woran man es erkennt, aber man hört es eigentlich. Und tatsächlich, wenn man eine Rolle verkörpert, ändert sich der Schritt. Das ist mir immer wieder aufgefallen. Das ist für mich immer das Merkzeichen gewesen, wenn ich darauf komme, aha, ich gehe anders, dann fange ich an, die Rolle zu haben. Dann fängt es an, interessant zu werden. Am Anfang probiert man halt alles Mögliche, auch in der Bewegung und so. Aber irgendwann rastet es ein und es kriegt einen bestimmten Grundcharakter. Das ist so ganz fein. Es ist nicht so, dass einem das so plakativ auffällt. Aber klar, natürlich ein energischer Mensch tritt anders auf als jemand, der zaghaft ist und vorsichtig ist. Dann wird der Schritt ein ganz anderer. Also es kommt das Grundtemperament auf des Menschen. Oder jemand, der ist sehr phlegmatisch, der hat vielleicht eher einen schlurfenden Gang darin. Also das drückt sich darin aus und das wirkt aber auch in die Sprache hinein.
Einstieg in die Praxis mit dem H-Laut. Sich selbst beim bewussten Sprechen erleben 00:13:28
Ja, ich glaube, das ist zur Einleitung einmal genug. Wir werden jetzt konkret in die Sprücherln hineingehen und ein bisschen was ausprobieren. Wir werden gemeinsam anfangen mit dem H, mit dem Hauch. Das H ist eben wirklich fast nur ausgeatmete Luft, nur ganz klein wenig geformt. Stärker geformt wird es, wenn es ein CH wird. Im Hebräischen zum Beispiel ist es ganz ganz deutlich, dass da ein Bewusstsein dafür war, wenn der Hauch drinnen ist, dann hat es was mit dem Seelischen zu tun, mit dem eigentlich körperlos Seelischen geradezu. Das ist so wie der Mensch, wenn er seinen letzten Atemzug macht und die Seele sozusagen mit dem letzten Atemzug in den Kosmos hinaus strömt. Da spürt man den Körper nimmer. Wenn es CH wird, wenn es sich anfängt zu reiben, ist es das erste Zeichen, wo es vom Körper gefasst wird, weil da ist der Widerstand des Körpers da, an dem es sich reibt. Und wenn ich dann zum Beispiel TSS, TSS gehe, TSS gehe, dann wird es ganz ganz eng, ganz scharf. Da tritt der Körper sehr sehr stark hervor, die Zähne und so weiter, die sich entgegenstellen.
Und dieses Spektrum wollen wir versuchen beherrschen lernen, einfach selber, bewusst, nicht einfach nur unbewusst, so wie wir eshalt im Alltag machen, weil im Alltag sprechen wir, wie wir es durch Nachahmung in der Kindheit gelernt haben, wie uns das Leben geformt hat. Wir sind uns gar nicht bewusst oft, was da drinnen liegt. Wir denken an den Inhalt der Sprache, aber nicht an das Wie. Und es geht jetzt bitte nicht darum, ich muss jetzt immer nachdenken, wie soll ich es machen? Nein, das muss aus der Intuition herauskommen, aber ich kann wach mir selber zuhören, was passiert dabei. Und das ist eigentlich ein gewaltiges Erlebnis, weil da wird etwas spürbar, was man im Alltagsleben überhaupt nicht mitbekommt und wo aber die ganze Person, die ganze Identität eigentlich drinnen liegt. Die eigene oder eben dann auch der Rollenfigur, die da drinnen liegt.
Und da darüber zu stehen, das mitzubehorchen und eben auch dann mitzuerleben, den Schritt, die Gestik, wie sie ist, wie frei sie ist, wie verhalten sie ist, wie energiegeladen sie ist, wie sich jeder einzelne Muskel betätigt drin, das sollte man alles spüren. Also wach in dem werden. Das ist unser gegenwärtiges Zeitalter, Bewusstseinsseelen-Zeitalter. Ich weiß schon, im Alltag schafft man das nicht dauernd. Da wird man wahrscheinlich, wenn man über die Straßen geht, überfahren werden. Das ist zu viel. Aber zumindest, wenn man mit anderen Menschen spricht, dann sich ein bisschen bewusst, was liegt da drinnen. Weil oft kann ich auch dadurch unbewusst zum Beispiel eine Antipathie, eine Ablehnung ausstrahlen, die auf den anderen aber auch so wirkt. Und das will ich vielleicht bewusst gar nicht. Ich will eh freundlich sein zu ihm. Aber eigentlich ist er mir unsympathisch in der Tiefe. Und das liegt in der Stimme dann irgendwo drinnen. Und liegt in der Körperhaltung irgendwo drinnen.
Die Wahrnehmung der eigenen inneren Haltung macht es möglich, auch die Geisteshaltung anderer Menschen zu erkennen 00:17:00
Und wenn man aber sich dessen bewusst wird an sich selber, dann kann man auch bei den anderen wie in einem offenen Buch lesen. Man weiß sofort, wie ehrlich ist das, was er meint, was er sagt. Selbst wenn er gut geschult ist, man merkt die Untertöne, die drinnen sind. Sie verraten sich in jeder kleinen Bewegung, in jeder Klangnähe aus verraten sie sich. Also das heißt, da sieht man mehr. Und das ist jetzt bei Gott noch nicht Hellsichtigkeit oder irgend so etwas. Aber man sieht trotzdem, wie sich die Seele und die Geisteshaltung auch da drinnen ausdrückt. Wie trägt sich der Mensch? Wenn ein Mensch Haltung hat - wie soll ich sagen - auch im moralischen Sinn, wenn man es so nennen will, es hat auch etwas damit zu tun, wie bewusst kann ich mich tragen oder wie weit lasse ich mich durch das Skelett nur tragen. Wie weit trage ich mich selber? Wie führe ich mich durch den Raum?
Und das ist eine tolle Übung, sich selber so zu erleben, als würde man sich wie ein Puppenspieler selber führen. Das heißt, ich, mein Körper, bin eigentlich die Puppe, aber ich führe mich, ich stehe mit meinem höheren Ich eigentlich über mir und schaue mir zu. Was tue ich da? Nicht, dass ich jetzt gedankengesteuert sage, ich muss es jetzt so machen, dann wird es unecht. Aber ich erlebe mit, was drückt sich aus in meiner Bewegung? Was lebt darin? Stimmt es mit dem zusammen, was ich eigentlich ausdrücken will, oder ist da eine versteckte leise Aggression drinnen? Oder ist eine versteckte Angst drinnen, und so weiter. Also, das kann man miterleben dadurch.
Persönliche Erfahrungen mit der Sprachgestaltung - ein Weg zum natürlichen und unbefangenen Sprachausdruck 00:18:44
Also ich schildere das jetzt natürlich aus meinem Erleben heraus. Das war für mich damals, wenn ich in die Sprachgestaltung zufällig hineingekommen bin und etwas später dadurch dann zur Anthroposophie, von der ich zu der Zeit überhaupt noch nichts wusste, gekommen bin. Ich hab gesagt: Das gibt es ja nicht, was man da alles neu erleben kann und was ich bis jetzt verschlafen habe! Und um das vielleicht noch persönlich zu ergänzen, ich kam zur Sprachgestaltung, weil ich Hemmungen hatte, vor Menschen zu sprechen. Komplette Hemmungen! Ich habe mich so, wie es irgendwie geht, nur schon in der Schule drum herum gedrückt. Aber ich verrate … bin ich immer schwer erkrankt. Und das habe ich immer geschafft, dass es bis zum Schulschluss sich keine Gelegenheit mehr gegeben hat. War nicht immer gut für meine Noten, aber - Panik, Panik! Und ich war drei Abende oder was in der Sprachgestaltung - und es war weg und ist bin ins Gegenteil umgeschlagen. Eigentlich eine Freude. Ach, sprich doch. Sprich doch. Lass es heraus. Einfach. Schildere doch, was du erlebst. Das ist ja gar keine Hexerei. Das ist ja schön, das zu teilen mit anderen Menschen. Nicht nur da drinnen verstecken irgendwo, sondern es zu teilen.
Einstieg in die praktischen Übungen: Vokalübung A 00:20:03
Gut, aber jetzt gehen wir in die Praxis. Fangen wir an. Ja, machen wir es am Anfang einmal im Stehen, würde ich sagen. Eben um gleich die Haltung zu spüren. Also versuchen wir einfach die Haltung zu spüren, das sich selber tragen, dass wir uns dessen bewusst werden einfach. Wir brauchen keine besonderen Verrenkungen, wir brauchen einfach nur spüren, das aufrechte Stehen. Und fangen wir an mit den Vokalübungen einmal, damit wir das Seelische haben. Ja, genau! Am Anfang. Also beim A möglichst den Mund, wenn wir es eben nicht A machen, weil dann ist es auch gequetscht, aber deutlich ihn öffnen. Also nicht nur A, A. Und das bei jedem A. Weil ich schwöre, man hört es sofort, ob der Mund wirklich offen ist, dass eben der Klang hinausgehen kann oder ob es etwas verhalten ist. Es ist sofort vom Klang 20, 30 Prozent weniger.
Und im kleinen Gespräch spielt es keine Rolle, aber wenn ich auf der Bühne oben stehe und das Burgtheater füllen soll und noch wie in alter Zeit keine Mikrofone es dazu gab und Lautsprecher, die das dann verstärken sollen, wo ich mit meiner Stimme den Saal füllen muss, dann merkt man sehr deutlich den Unterschied. Weil da ist jedes Prozent wichtig, dass es bis hinauf trägt in den obersten Rang. Also bis rauf. Gut, am Anfang. Also versucht einfach, bewusst bei jedem A darin zu sein, zu erleben dieses sich öffnen, sich bewusst verlieren an die Welt, hinauszugehen. Ich meine, das ist das, was zum Beispiel hinter dem Wort Allah darin steckt. Das ist das Erlebnis. Die Wüste. Ich stehe da und verliere mich in dieser unendlichen Weite, die da draußen ist. Das ist das Erlebnis, das dahinter steckt. Und das L darinnen macht es sehr beweglich, lebendig, das Ganze.
Aber ich gehe da hinaus, ich atme mich hinaus und gehe eigentlich ins Göttliche hinein, mit meinem Atem. Mit jedem Atemzug. Weil mit jedem Atemzug, wo wir ausatmen, ist es so ein bisserl wie in die jenseitige Welt gehen, wie in die Welt, wo wir hingehen, endgültig, wenn es der letzte Atemzug ist. Aber ein Hauch davon ist bei jedem Atemzug drin. Immer, wenn wir ausatmen, gehen wir in diese Welt. Wir wachen halt noch nicht ganz auf dafür. Und wenn wir einatmen, wenn es presst, dann spüren wir uns da als Irdisches. Wenn wir nur einmal ganz stark einatmen, dann spüren wir, wie das im Körper dann zu spannen anfängt. Wenn ich mich so wirklich voll mich sauge mit Luft, das presst, es drückt. Und dann loslassen. Das ist im Seufzer zum Beispiel. Loslassen. Auf einmal hört die Beklemmung auf. Beklemmung ist totales Einatmen und nicht mehr Ausatmen. Das halten wollen, sich festkrallen da drinnen. Das tut aber weh, macht aber auch wacher. Aber dann ausatmen, ins Träumerische zumindest zu kommen.
Also diese Schwankungen in der Seelenstimmung auch, versuchen wir einfach mitzuerleben am Anfang.
„Am Anfang war das A
Als man das All am Tag da sah,
ward Adam wach.
War Sprachkraft da.
Sprach klanghaft A.“
Geheimnis der Sprache: Beim Zuhörer kommt die Wirkung eigentlich erst an, wenn das Wort schon verklungen ist. Die Bedeutung des Nachklingens in der modernen Musik 00:23:56
Genau. Und wichtig, bis ins Unhörbare seelisch dabei bleiben. Also, sprach klanghaft A, Punkt, Aus, Ende. Sondenr - ahhhh - bis die Luft weg ist und selbst dann noch einen Moment dabei bleiben und es nachwirken lassen. Weil das Geheimnis bei der Sprache ist, auch im Zuhörer kommt die Wirkung eigentlich erst, wenn das Wort schon verklungen ist. Und daher sind auch sehr wichtig Pausen drinnen, dass das Publikum Zeit hat, das, was es aufgenommen hat, zu erfassen, zu verdauen irgendwo. Also wenn ich einen Monolog halte und ohne Punkt und Komma durchspreche, kriegen sie unter Garantie nichts mit. Sondern sie brauchen Zeit, weil sie atmen das im Grunde bildlich gesprochen jetzt ein, das, was ich mitgebe, der Sprache. Und sie müssen es in sich jetzt erst zur Entfaltung bringen, der Klang ist weg und jetzt wirkt es. In der Musik ist das genauso. Daher sind die Pausen ganz, ganz wichtig. Was oft auch in der modernen Musik ist, da ist einmal ein Ton, dann ist nichts und dann kommt wieder irgendein Ton, man erkennt eigentlich gar keine Melodie mehr und man lauscht nur, wie der Ton verklingt. Dann ist er weg und jetzt kommt aber ein Erleben, wenn man wach genug dafür ist. Also das ist auch wichtig, dort wo nichts gesprochen wird, wo nichts klingt, sondern wo es verklungen ist, aber im Zuhörer auflebt. Das ist wichtig.
Gut, machen wir es noch einmal gemeinsam:
„Am Anfang war das A
Als man das All am Tag da sah,
ward Adam wach.
War Sprachkraft da.
Sprach klanghaft A.“
Schön, schön!
Der Vokal E und seine Schärfe. Gestik und Ausdruck beim E können vielfältig sein 00:26:00
Gegenbild dazu jetzt zu diesem sich Verströmen: E - sich sperren. Ich sage ja immer, das ist so bissl: Ich habe da meinen Gartenzaun und schaue sehr kritisch zu meinem Nachbarn hinüber. Durchaus nicht freundlich, sondern: Bitte, da ist meine Grenze! Und schon wenn du rüber schaust, ist mir das unangenehm. Nicht, dass ich das jetzt empfehlen möchte, aber es ist so eine der Seiten des E drinnen. Also ich setze Grenzen. Ich setze Grenzen - bis da her und nicht weiter! [Wolfgang kreuzt die Arme vor dem Körper] Und ich spüre mich selber. Daher E-Gesten, wir machen so viele E-Gesten, Redner, so oder so [Hände reiben]. Unterschied zum Beispiel, manche machen dann so vielleicht sogar, oder so, auch ein an sich Halten, ich spüre mich da [Faust formen]. Gewerkschaftsführer: Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, so geht es nicht weiter! [Schüttelt die Fäuste] Kraft drinnen. So, meine Kolleginnen, so geht es nicht weiter! [Schüttelt die Fäuste] Anders, wenn ich es ganz sanft offen mache: So, meine Kolleginnen, so geht es nicht weiter … Und die E-Geste, was ist, wenn ich es so mache? [Finger reiben an den Schläfen] Ist da ein Unterschied? Oder wenn ich es so mache? [Am Kinn fassen] Auch alles mich selber spüren, mich selber anhalten, oder ich mache so [Am Kinn reiben]. Nur Redner beobachten!
Wenn ich da ganz vom Kopf her [Deutet auf die Schläfe] … ich hole alles aus den Gedanken heraus, da viel mehr aus dem Gefühl [Hände an den Wangen]. Ich fühle es. Oder auch da, mit den Händen geht es. Redner, die so immer machen, [Die gespreizten Finger gegeneinander stoßen] sind ganz … sehr abstrakt, sehr im Gedanken. Aber Gefühl, Wille, ist nicht wirklich stark beteiligt, sondern es ist hauptsächlich das Gedankliche. Wenn es so ist [Hände reiben] - ich mache das gerne im Übrigen - ich habe mich schon selber beobachtet, dann ist es, ich fühle es. Und eben mit der Faust, wenn ich die mehr balle [Faust ballen], oder mich sehr verkrampft anhalte, dann ist es kein Fühlen, dann ist da Wille drinnen, Kraft. Ich will mich durchsetzen - so muss es sein, ich will es! Aus! Und da gibt es keine Wiederrede im Grunde. Also diese Dinge beobachten drinnen, das liegt alles im E-Charakter drin.
Und versuchen wir jetzt, das E zu machen: … Dem strebt … Und zwar die ersten beiden Zeilen, versucht es streng zu machen, schneidend, schneidend, unangenehm! Das ist so verstärktes Zähne fletschen. Bitte nicht die Zähne sich ausbeißen, aber bewusst einmal scharf sein. Die ersten zwei Zeilen, und dann komplett umwenden, obwohl das E eigentlich diese Schärfe und diese Abgrenzung hat, es so warm wie möglich zu machen. Es gibt ja eben doch immer einen Spielerraum, und die Unterschiede sind auch immer wichtig. Also wenn ich alles gleich mache, im gleichen Klang, Schema bleibe von A bis Z, dann habe ich ein gutes Mittel, das Publikum einzuschläfern. Also manchmal ist es gut, jetzt mache ich eine leise Passage, jetzt fange ich schon an, ein bisschen mitzuträumen mit dem Ganzen, und dann fahre ich mit etwas Stärkerem rein z.B. Wird es kräftiger, dann sind sie wieder wach. Also da kann man einfach spielen damit.
So - also die ersten zwei Zeilen scharf!
„Dem strebt entgegen E.
Erkennt der Mensch den Menschen je.
Des Evchens Welt, er enger seh.
Es lebt dem E.“
Ja, gut! Schöne Worte drinnen, wie „enger” z.B. E, da ist das E, es ist das N, das N ist so ein bisschen die Verneinung, das ich drücke etwas weg von mir, nein, will ich nicht! Und G, das ist auch gewaltig, was Großes, weg, aber groß, mächtig. Also „enger”, ich gehe in die Enge und ich schiebe dann alles, den Rest der Welt weg irgendwo. Es ist so drinnen ein bisschen. Ist jetzt mein Erlebnis, also man kann verschiedene Aspekte finden in dem Ganzen. Wichtig ist nur, ich erlebe was. Ich kenne das Wort „enger”, ich spreche es schon mein ganzes Leben lang und erlebe eigentlich gar nicht, dass in dem Wort selber drinnen eine ganze Riesengeschichte drinnen steckt. Das ist das Spannende, das mitzuerleben, selber mitzuerleben, aus dem kann ich schöpfen und aus dem kommen dann auch unheimlich viele Inspirationen. Im Sprechen, das holt was herein, wenn ich es so miterlebe, dann mache ich es nicht nur aus einem absagten Gedanken, sondern ich fühle mit und ich feuere auch den Willen an. Und der Wille ist ja das Tätige, das eigentlich Schöpferische, das was tut, das formt, das gestaltet. Und das heißt, ich fange an, dann wirklich mit dem Gedanken mitzufühlen und zu gestalten, mitzugestalten. Und dann wird es reicher einfach, dann ist es nicht mehr so eine abstrakte Linie, sondern es wird voll einfach, man schöpft aus dem Vollen heraus.
Vokalübung I und die Bedeutung des CH 00:31:48
Gut, nächstes. Tief in tief … Wenn man es für die Bühnensprache nimmt oder wirklich bedeutsam machen will, das Wort inni-ch. Ein leichtes ch am Ende. Man muss es nicht übertreiben, nicht dass es zu norddeutsch wird. Ich liebe dich ganz inni-ch [stark akzentuiert gesprochen]. Inni-ch. Oder der Köni-ch kommt. Horcht auf den Unterschied: Der König kommt. Der Köni-ch kommt. Empfindet ihr da einen Unterschied? Eleganter. Es ist eleganter, es ist bedeutsamer. Wenn ich sage: Der König - man kann ja sagen, der Herr Meier kommt, das ist egal, irgendwer kommt halt. Aber der Köni-ch … in dem ch ist etwas fast wie eine Aura drinnen. Es hat etwas Verbindendes. Ja, es hat etwas Verbindendes. Es wird viel größer irgendwo, viel verbindender irgendwo das Ganze.
Also daher versuchen wir, das tief innig zu nehmen. [Ohne Ausdruck gesprochen] Ich liebe dich so inniglich - Na ja. Tief!
Tiefinnig liebt sie I.
Dies Licht in sich, ihr Kind will sie.
Dies lieblich Ding, wie's singt, wie's schrie.
Ihr Kind ist I.“
Das deutsche Wort „Ich“: Der aufgerichtete Mensch, durch den der Sonnenstrahl durchgeht, mir meine aufrechte Haltung gibt und bis in die Erde hinein wirkt 00:33:20
Genau, das war also der Vokal i. Da kann man es auch in der Haltung besonders betonen, dass man sich selber auch streckt. Wenn ich es i spreche, wäre es schön zu erleben ein bisschen, ich strecke mich darin. Ich bin Lichtstrahl, der Lichtstrahl geht durch mich durch oder von mir aus, er geht vom Himmel durch mich durch in die Erde, wie auch immer. Also das ist ja unsere Haltung.
„Ich“, „Ich“ - das Wort „Ich“ist genial, das deutsche Wort „Ich“. „Ich“, der aufgerichtete Mensch, durch den der Sonnenstrahl, sozusagen bildlich gesprochen, der von der Sonne kommt, durch mich durchgeht, mir meine aufrechte Haltung gibt und bis in die Erde hinein wirkt. Ich atme. Der aufrechte, atmende, sehr selbstbewusste Mensch. Das steckt als Bild hinter dem Wort „Ich“. Ich kann natürlich andere Bezeichnungen in anderen Sprachen auch haben, aber beim deutschen Wort ist das die Gelegenheit, das zu spüren. Mich, als durchlichteten, aufrechten Menschen zu spüren, beseelt durch den Atem. Das „I“, der Lichtstrahl, das ist das Geistige sozusagen und das „ch“ ist der Atem, der durchströmt zugleich das Seelische.
Mit jeder Gefühlsstimmung ändert sich auch der Atem. Wenn ich bewusst im Erleben meines Atems bin, bringe ich auf diese Weise eine Stimmung an Zuhörer heran, die im gleiche Rhythmus mitatmen 00:34:44
Weil mit dem Atem hängt sehr stark das Seelische, das Gefühl auch zusammen. Merkt man ja, wenn man Atembeklemmung hat, kriegt man sofort Angst. Ich kriege keine Luft mehr. Dann Panik steigt auf. Wenn ich ganz entspannt bin, ist der Atem ganz ruhig. Dann geht er ganz ruhig, regelmäßig und ich fühle mich wohl dabei. Also gerade das Gefühlsmäßige hängt sehr, sehr viel mit dem Atem zusammen, wie der strömt. Und mit jeder Gefühlsstimmung, die ich habe, ändert sich etwas im Atem auch drinnen. Und das ist im Übrigen auch ein Mittel, um ans Publikum, an die Zuhörer die Stimmung heranzubringen. Wenn ich deutlich genug atme, man muss es nicht überzeichnen, es soll dem Publikum äußerlich gar nicht auffallen, aber ich atme trotzdem bewusst und bin mit meinem Erleben im Atem drinnen, dann wirkt es so, dass das Publikum beginnt mitzuatmen, im gleichen Rhythmus.
Und das heißt aber, ich löse im Publikum in Wahrheit so ganz leise die Seelenstimmungen aus, die ich da ausstrahle. Und die geht ins Publikum über. Das sind Werkzeuge, die man im Übrigen sehr missbrauchen könnte, um Menschen zu manipulieren. Aber es kann auch eine Hilfe sein, um ihnen zu zeigen, ja was geht denn mir vor? Sodass ich selber nicht nur von außen ja, der ist jetzt traurig oder nein, die freut sich gerade sehr, sondern wirklich, dass in einem selber das Erleben des anderen aufwacht. Das ist auch immer ein Mittel, wenn man anderen Menschen zuhört, zu achten, wie liegt das in ihrem Atem drinnen? Dort spüre ich ja wirkliches Erlebnis. Nicht nur er sagt mir, mir geht es eh gut, aber am Atem spüre ich, es geht ihm gar nicht gut. Da sind immer Stockungen drinnen, da ist eine Hemmung drinnen, da ist etwas. Das äußerlich kann er ganz was anderes sagen, als er in Wahrheit erlebt. Und das kann ich auf die Art mitbekommen. Das sind eben die Untertöne. Und das ist alles kein übersinnliches Wahrnehmen, das ist absolut sinnliches Wahrnehmen. Aber ein Aufmerksamwerden auf etwas, worauf wir normalerweise nicht aufmerksam sind.
Das EI und sein vielfältiger Ausdruck am Beispiel der Wienerischen Dialekte 00:37:11
So. Ei. Ei. E, I. E, I, das ist interessant, das hat natürlich irgendwo den … ist ein eigener, eigener Klang, nämlich. Es ist nicht nur eine Zusammensetzung von E und I, sondern es bekommt etwas Weiches. Wir sagen es ja Ei, Ei - Ei, Ei [Streicht über die Wange]. Das ist weich, sanft. Da ist das E absolut gemildert. Und es ist interessant, auch das I ist gemildert. Weil das I kann auch sehr, selbst wenn es lichtvoll ist, aber auch so ein scharfer Lichtstrahl … das kann eigentlich auch was Kräftiges zumindest sein. Denkt an einen Laserstrahl oder so, sozusagen als äußeres Bild, da ist Gewalt, Kraft drinnen. Im E, I wird es irgendwie ausgewogen, es wird weicher, sanfter. Und es ist trotzdem aber Kraft drinnen, aber nicht so nach außen strahlende, sondern verinnerlichtere Kraft. Ei. Ei, Ei, weich. Versuchen wir das. Und da wir ja hier in Wien sind, in Wien gibt es den Bezirk Meidling, da sprich man das I etwas anders aus. Da würde der Spruch sein: „Sei fein, sei mein, meint Ei, sein Schein eint zwei, streicht weich Ei, Ei.” Es ist also nicht so ganz so weich, wie es sein könnte. Man kann es aber auch aristokratisch machen. „Sai fain, sei main, meint Ai, sain Schain maint zwai, straicht waich Ai, Ai.” Dann wird es schon so fast wie A, Y oder irgend so. Also es wird ein bisschen abgehoben, das Ganze. Also versuchen wir einfach die mittlere Ebene.
„Sei fein, sei mein, meint Ei
Sein Schein eint zwei, streicht weich; ei ei.
heilt gleich, streicht seicht, bleibt leicht.
Sei frei, bleib rein beim Ei.“
Schön!
Im Grundcharakter des O liegt die Umarmung 00:39:40
Wieder verstärkt, das ist das Geniale an den Sprüchen. Zum Beispiel beim -Ffff, da ist ein ziemlich scharfer Atemstoß drinnen auch. Also ich trage es hinaus, dadurch wird es modifiziert oder frei sogar. Rrrr ist … da rollt es, das ist wie eine rollende Maschine, das R. Da ist immense Willenskraft drinnen, ist fast der stärkste Willenslaut, Triebkraft geradezu die drinnen ist. Auch wenn man es nicht stark formuliert, es ist trotzdem immer im Hintergrund leicht drinnen. Also in jedem Wort steckt ein ganz bestimmtes Erleben, das uns heute gar nicht mehr bewusst ist. Ja Freiheit, ja wissen wir eh was es bedeutet. Aber erleben wir, was drinnen ist? Das Ffff, ich gehe mit dem Atem hinein, pfff und rrrr und hab da, Triebkraft, von da her [deutet auf den Körper], da ist Kraft drinnen. Das frei! Und dann Ei, Ei und da wird es jetzt nicht mehr ganz so weich, sondern durch den Untergrund wird sowohl das E stark als auch das I stark im Grunde. Also da gehe ich sehr bewusst, sehr zielbewusst und gehe meinen Weg und lasse mich nicht aufhalten. Und Hindernisse werden weggeräumt sozusagen. Und das drückt sich einfach aus, selbst wenn es nicht so bewusst gesprochen wird, aber die Redner verraten sich dadurch, was drinnen ist. Man spürt es trotzdem drinnen. Also auf das soll man aufmerksam werden.
So! O. O. O. Da wird der Mund so schön rund. Nicht umsonst im Übrigen, die Buchstaben haben auch einen Sinn. Das I ist nicht zufällig so ein Zeichen, sondern das ist eben dieser Lichtstrahl, diese gerade Linie. Das I hat auch was zu tun mit der hinweisenden Geste. Das hat I-Charakter. Von mir strahlt etwas aus. Oder durch mich strahlt etwas durch. Aber es strahlt auf jeden Fall.
Im O. O. Hört man es an, den Unterschied zwischen A. A. Ich verliere mich an die Welt [Breitet die Arme aus]. O geht auch hinaus, aber es wird da rund. Wenn ich sinngemäß die Gestik mitmache, wenn ich O … O wird eigentlich nicht ganz zusammenpassen. Kann ich natürlich machen. Ich kann immer Gegensätze auch vereinern irgendwo. Aber es ist eher „O, O, O, ihr seid aber lieb.“ Also ich umarme euch eigentlich symbolisch. Wenn ich grüße oder so, ist immer das ein bisschen drinnen. Das Umarmen eigentlich. Ich grüße nicht so [winkt], das heißt, ich gehe weg im Grunde. Einen beschränkten Kreis von Menschen sozusagen zu umfassen irgendwo - das liegt als Grundcharakter im O drinnen. Und das ist eine Stimmung, die man benutzen kann. Wie gesagt, zum tausendsten Mal, man kann auch immer dagegen arbeiten. Natürlich an manchen Stellen. Und den Laut vergewaltigen sozusagen. Und bewusst damit das Gegenteil produzieren. Man ist frei darin. Aber es hat auch einen eigenen Grundcharakter. Und das ist gut, wenn ich den kenne. Auch wenn ich vielleicht jetzt bewusst gegen ihn arbeite. Dann hat das nämlich auch eine Wirkung. Da entsteht so ein Spannungsverhältnis zwischen dem, was es eigentlich ist und dem, wie ich es aber jetzt mache. Und das erzeugt dann einfach so wie … da springt der Funke über. Das hat was Besonderes. Das ist gefüllt noch geradezu durch eine Auseinandersetzung, die drinnen liegt. Das sind also die Feinheiten, die man reinlegen kann. So, also O:
„Doch gottvoll groß, kommt O;
stoßt vor, vors O, voll Ton. Wohl so,
von Kosmos, Logos, o so froh,
von "Wort", kommt O.“
Genau. Genau.
Der Charakter des U ist Enge, Rückzug ins Innere. Ein häufiger Laut in der englischen Sprache 00:44:19
Jetzt geht es ins U hinein. U. Versuchen wir nochmal das U zu sprechen. U. U. Jo, U. Das wird so ein Schnoferl, wie man bei uns im Wienerischen sagt. Es wird eng. O ist rund, aber U, U, U … Und was hat man für Stimme? U, U, U. Es ist so ein bisschen dunkel. Vielleicht Nacht. Oder unheimlich kann auch drinnen sein. Eng. Eng. Die Haltung wäre dann … und so schreibt man es auch im Übrigen. Ganz zufällig sind sie nicht die Buchstaben, so willkürliche Zeichen, sondern: Erlebt mich, geh in die Enge. Also wenn ich mich vorstelle, vom A gehe ich jetzt ins U. Bin ganz eng in meiner Burg. My home is my castle. How do you do? Im Englischen sind viele U drinnen. Das ist diese Haltung. Also gewisse Steife vielleicht auch drinnen, gewisse Enge drinnen. Die Enge bewirkt schon ein bisschen Unbeweglichkeit - als Seelenhaltung, so als Grundstimmung irgendwo.
Natürlich kann jede einzelne Individualität trotzdem ganz anders sein. Aber es ist so eine Grundstimmung drinnen. Natürlich, das Klima ist auch anders als bei uns. Also es ist dieses … auch wenn ich im Winter rausgehe … Ahhh … wenn es ist eiskalt draußen und ich mache alles auf und dann werde ich wahrscheinlich schnell eine Erkältung haben. Dann gehe ich eher ins E vielleicht hinein. Mich anhalten, mich wärmen an mir. Oder eben ins U hinein … brrr, zieh mich zurück irgendwo, ins Innere, in mich selbst hinein und schaue vielleicht so als Beobachter, aber als unbeteiligter Beobachter auf die Welt. Nicht umsonst … sie kommt gerade aus dem englischen Sprachrahmen sehr stark … dieses die „objektive Wissenschaft”. Die heißt, ich schalte mich eigentlich als Beobachter im Grunde aus. Ich bin ganz unbeteiligt. Ich nehme nur wahr, was da draußen passiert. Und ich bin eigentlich gar nicht beteiligt. Sondern ich trenne mich, ich trenne mich von der Welt. Im A das genaue Gegenteil. Ich verbinde mich. Ich gehe sogar ganz auf. Ich vergesse mich im Grunde dabei. Also „Und durch und durch“ …
„Und durch und durch muss U,
durch Gruft und Schlucht ruft’s Mut uns zu;
durch Gut und Blut, durch Furcht musst du
zur Frucht durch's U.“
Ja, gut. Gut!
Umlaute - Im AU verbinden sich die Extreme: Das enge U mit dem weiten A 00:47:15
Und jetzt kommt eine spannende Kombination: Das U verbinden. Das ganz Enge mit dem ganz Weiten. A - U. Au. Ein eigener Klang noch - das Au. Also so ein Zwielaut einfach, der aber jetzt wirklich das ganze Spektrum vereinigt zwischen dem größten und dem engsten. Aus Raum …
„Aus Raum, aus Laub, raunt AU;
aufbraust’s aus Baum, aus Laub rauscht AU,
lausch drauf auf's AU, aus Traum aufschau!
Bau, trau aufs Au!“
Gut.
Und jetzt machen wir zum Abschluss der Vokale noch da diese Umlaute: „Schwäne fliegen öfters über Bäume.” Schwäne! Man kann's auch natürlich sehr übertreiben: „Schwäne fliegen öfters …” Dann ist schon ein bisschen exaltiert die ganze Sache. Versuchen wir's also so ein mittleres. „Schwäne fliegen öfters über Bäume. Gääähnen sie öfters übelmäulig …” Also im Gähnen wirklich ganz aufmachen. Im übelmäulig macht man eher zu, wenn man Mundgeruch hat oder was, Verzeihung. Und „Spräng er nie öfters über Zäune.” Geläufigkeitsübung. Tempo. Was geht! „Spräng er nie öfters über Zäune”… z- z- z, drüber!
Also, Schwäne …
Schwäne fliegen öfters über Bäume.
Gähnen sie öfters übelmäulig?
Spräng er nie öfters über Zäune.
Zäune! Ich bin über Bäume gesprungen. Macht nix. Na, kleine Bäume. Da geht's noch.
In der Pause Reflexion und Gespräch über die Bedeutung des richtigen Atmens im Zusammenwirken mit der Haltung beim Sprechen 00:49:28
Ich würd sagen, machen wir eine kurze Pause. Was hältst du davon François, bevor wir zu Konsonanten gehen? Ich seh schon, wenn wir da durchgehen, brauchen wir stundenlang. Atmen wir kurz durch. Setzt euch einmal nieder. Will wer was trinken? Kaffee? …
Das Blut kreist anders und das Durchatmen, vor allem das wirklich gute Ausatmen, das ist so wichtig.
Teinehmerin: Ja, das merk ich bei diesen Übungen, dass auch ich sehr viel aus dem Kehlkopf mach. Man müsste eigentlich alle Lehrer zu dir in die Lehre schicken, weil sämtliche Lehrer, glaube ich, haben das Problem, dass sie versuchen … erst einmal müssen wir versuchen, eine Klasse zu überschreien, und wenn du das aus dem Kehlkopf machst, wir haben alle Kehlkopf-Geschichten im Laufe der Jahre.
W.P.: Ja, absolut. Aber das Geheimnis ist eben wirklich die Resonanz. Das ist nur der Dirigent in Wahrheit. Entweder da oder oben.
Teilnehmerin: Ja, aber auch die Atemstütze.
W.P.: Ja, die Atemstütze muss da sein, genau.
Teilnehmerin: Aber jeder redet davon - nur wie geht es wirklich?
Ja, das ist richtig. Eine Voraussetzung ist eben schon einmal eine ordentliche Haltung, dass ich wirklich in der Aufrechten bin, weil wenn ich ein bisschen nur hänge in mir, ist das meiste schon abgesperrt, irgendwo. Und wird niemand richtig durchatmet. Und dann ist natürlich, wenn ich jetzt -hell - hell … sieht man eh, wie es sich da bewegt - hell - die Kraft kommt von da unten. Nicht von da oben. Der Klang entsteht da oben, aber die Kraft kommt von da unten. Und da sind genug Muskeln, indem sie das zusammenpressen, das geht schon. Und da muss ich aber auch wirklich einen Atemstoß haben, weil wenn es hell, wird es nicht hell! Dann ist es ein kurzer, scharfer Stoß und das oben scheppert.
Teilnehmerin: Und beschäftigst du dich z.B. auch manchmal mit Kehlkopfkrankheiten? Weil es gibt viele Leute, die sind heiser. [François möchte weitermachen, weil sich die Beleuchtung aufgrund der Dämmerung ändert] Also Kehlkopfkrankheiten, wie Verschleimungen, Heiserkeit und so.
W.P.: Nein, eigentlich nicht. Ist aber mit der Sprache umgehen sicher eine Unterstützung. Kann ich mir vorstellen, ja. Wir müssen es ja jetzt nicht mit voller Kraft machen, dämpfen es ein bisschen, weil ich weiß, es ist am Anfang anstrengend. Wenn man es nicht gewohnt ist.
Teilnehmerin: Für mich ist es okay.
W.P.: Gut, tun wir.
Konsonanten sind formende Elemente. Spruch: Des Himmels Hauch 00:52:35
Jetzt kommen die Konsonanten. Jetzt kommen die Konsonanten. Wir fangen mit des Himmelshauch an. Also jetzt eben dieses erste, das H, das Ausatmen, als der Urkonsonant in einer gewissen Weise: Ausatmen. Daher wirklich, wenn ich Kraft reingeben will, nämlich Seelenkraft oder Geisteskraft in dem Fall sogar, brauche ich genügend Atemluft, die ich einsetze und die loswerde und wieder einatme dann, nicht schau, dass ich endlos durchkommen muss mit dem Atmen. Das ist anders als beim Singen. Unter Umständen wirklich eine Silbe und ein voller, tiefer Atemzug ist weg und ich kann ohne weiters mitten in einem Wort sogar atmen. Das wäre die Frage, wann darf ich wo atmen? Wenn man die Luft ausgeht, atme ich. Und das ist völlig natürlich und authentisch dann. Egal wo, an welcher Stelle es ist, auch wenn es scheinbar den Sinnzusammenhang zerreißt und man denkt, ich muss den Bogen fertig machen, aber am Ende röchle ich schon nur mehr im Grunde, dann wirkt es nicht so, dann atme ich einfach. Und das wirkt viel natürlicher, als man es denkt einfach.
François: Okay, ich bin soweit.
Wir stürzen uns jetzt in die Konsonanten. Die Konsonanten sind das formende Element in der Sprache. Und wir werden beginnen mit dem noch am allerzartest formenden, mit der ausgeatmeten Luft, fast nur mit dem H. Da ist noch kaum etwas anderes, es ist der ausgeatmeten Luft kaum ein Hindernis entgegengestellt. Die Konsonanten-Geräusche sind nämlich keine Klänge. Klingen tun die Vokale. Die Konsonanten geben immer Geräusche. Die Geräusche entstehen dadurch, dass zum Beispiel die Zähne als Hindernis im Weg sind und da reibt sich die Luft dran und dadurch entsteht das Geräusch. Das ist kein wirklicher Klang. Klang ist, da kann ich keine bestimmte Tonhöhe zuordnen, das ist ein weites Spektrum irgendwo, das da drinnen ist. Also es ist ganz etwas anderes. Aber es fängt ganz sanft einmal an, des Himmels Hauch. Versuchen wir das einmal.
Des Himmels Hauch
schuf Hall und Licht
aus Urweltrauch …
Aus Herzen bricht
der Sprache Hauch,
erwacht ein Ich.
Der Rache Fluch
der heil’ge Spruch
verhallt im Todeshauch …
Nachströmen lassen, dabeibleiben vom Bewusstsein noch, auch wenn nichts mehr verklungen ist. Nicht gleich mit dem nächsten reinfahren sozusagen, weil dann würg ich die Stimmung ab, sondern fast wie den heiligen Moment erleben, wenn der Mensch seinen letzten Atemzug tut. Natürlich dann auch nicht gleich zum Schreien anfangen, sondern das ist ein Moment des Innehaltens, des Wirkenlassens des ganzen Dings. Das sollte sein, einfach. Also immer am Ende dieses Ausklingen lassen, bis ins Unhörbare hinein. Das gibt die Möglichkeit dem Publikum in seelische Resonanz damit zu kommen.
Sprache ist als mehr als Information. In ihr steckt der ganze atmende Mensch mit seinem Seelischen drinnen 00:56:13
Weil solange ich noch im Tun bin, können sie es noch nicht richtig mitverarbeiten. Das geht nicht parallel. Das geht eigentlich … ja, sie nehmen die Worte auf und am Ende, wenn es jetzt ruhig wird, -hhh [haucht] … taucht es als Ganzes auf. Vielleicht eh nicht ganz bis ins Oberbewusstsein, aber zumindest da irgendwo, es kommt näher. Und das ist es. Weil sonst reduziere es einfach auf eine äußere Information. Aha, das Himmelsrauch schuf Hall und Licht aus Urweltrauch. Habt ihr es verstanden? Ja, gut. Und so weiter. Aus Herzen bricht der Sprache Hauch … Aha, bitte wieso? Aus meinem Herzen bricht … wo bricht da die Sprache? Mmh? Dann fangen sie an … verstehen nicht, was meint der Blödsinn? Sondern es miterleben lassen. Selber was der Körper tut, mit der Atmung tut … wir haben vorhin davon gesprochen, das Publikum beginnt und der Zuhörer beginnt im Idealfall mitzuatmen. Es wird ein Gemeinsames, es wird ein Einklang im Atmen. Dann kann man es fassen. Dann kann ich mich trotzdem dagegen stellen und sagen, ja, das glaube ich da alles überhaupt nicht. Aber ich habe es zumindest erlebt.
Ansonsten ist es nur abstrakte Information und Sprache ist viel, viel, viel mehr als Information. Das ist nur die Oberfläche. Da steckt immer der ganze Mensch dahinter. Ja … und es stecken auch die - das werden wir bei den Konsonanten jetzt dann deutlich sehen - auch die formenden Kräfte, die ich in der Natur erleben kann. Beim H ist es eben noch ganz leicht, aber wenn aus dem H zum Beispiel ein CH wird … Hauch, dann spürt man schon, es ist nicht mehr dieses körperlos werdende Ausgeatmete, sondern es reibt sich am Physischen, am Stofflichen. Kriegt schon eine andere Qualität, kriegt den Moment der Verkörperung oder von mir aus auch Entkörperung, wie auch immer. Aber ich spüre den Körper dabei stärker. Und das liegt drinnen. Und das sagt mir das Wort „Hauch” als Information aber nicht in Wahrheit. Aber da steckt eigentlich der ganze atmende Mensch drinnen mit seinem Seelischen, wie sich das ändert im Einatmen, Ausatmen. Welche Gemütsstimmung er dabei hat, liegt in den Nuancen dann drinnen, wie es ausgesprochen wird, das kann ich alles drinnen entdecken. Jeder Mensch, in dem man spricht, legt das offen. Und das kann man hören. Nur die meisten hören es nicht. Wir überhören es, weil wir uns nur auf die Information konzentrieren. Und die sagt von dem allen nichts. Die sagt mir nicht, wie geht es dir denn eigentlich dabei? Aber die Art, wie er spricht, wie der Mensch spricht, die sagt sehr viel davon. Wie geht es mir, welche innere Haltung habe ich zu dem, stehe ich dem positiv gegenüber oder abwartend oder gar ablehnend? Das liegt alles in diesen Tönen drinnen, die im Nachklingen erlebt werden können, wenn ich Raum dazu gebe.
Ein Weg, sich Elementarwesen zu nähern ist das bewusste Erleben der Sprache. In ihr leben Wesenheiten, die ich seelisch, geistig erleben kann 00:59:44
Gut. Jetzt wird es gleich scharf. Stauben. S und T. Das ist was ganz kräftiges. Staubend. Im Au. Au. Staub. Staub. Versucht es zu erleben. Von mir aus ein Wasserstau. Der schießt auf einen Felsen. Schießt auf den Felsen. Staube. In dem Moment mit T schlägt es auf auf dem Felsen und dann zerspritzt das Wasser nach allen Seiten. Stau! Staubend. Das sind dann die Wasserwölkchen, die nach allen Seiten wegspritzen irgenwo. Das sollte man drinnen erleben. Nicht nur: „Staubend, rauschend wälzt sich Wasserschwall … Aha, interessant, wo hat man das erlebt?” Ich muss selber Wasser werden, das mit voller Wucht, mit voller Kraft auf den Felsen prallt und -zerstäubt in alle Winterrichtungen. Das erleben, selber das Wasser werden.
Dann fange ich an zu verstehen, wie ein Rudolf Steiner von Wasserwesen, Undinen sprechen kann. Das ist genau das. Das ist das seelische Element, was da erlebt wird. Und was aber mit dem Wässerigen und in seiner Auseinandersetzung auch mit den Felsen oder wo drinnen lebt. Das ist das seelische Erleben, das drinnen steckt. Das kann ich nur innerlich erleben. Diese Undinen sind eine Realität, aber das sind nicht irgendwelche unsichtbaren Geister, die da herumschwirren. Das ist etwas, was wir erleben können. Was wir erleben können. Was aber im äußeren Naturgeschehen durchaus sichtbar wirksam ist. Aber da ist dieses Erleben dabei. Das ist der Weg zum Beispiel um Elementarwesen … oder einer der Wege, wo ich mich dem Elementarwesen nähern kann irgendwo. Was das ist … irgendwo. Sonst stelle ich mir immer irgendein Fantasiegebilde vor. Aber da ist es ein ganz konkretes seelisches Erleben. Und dieses seelische Erleben und das Geistige, was in den Konsonanten sich ausdrückt dabei, in dem leben diese Wesen drinnen. Und dadurch geben sie sich zum Ausdruck.
Und dadurch kann ich sie vor allem auch in der Sprache erleben zum Beispiel. Und das heißt, da wirken dieselben Elementarwesen auch drinnen. In der Sprache zum Beispiel. Und trotzdem ist es nicht einfach nur etwas willkürlich Subjektives. Ich mache halt, wie ich glaube. Es unterliegt ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten … bei jedem Konsonanten anders. So wie es bei jedem Vokal die Seelenstimmung anders ist und ganz charakteristisch ist, die Grundstimmung. Auch wenn ich sie natürlich dann verdrehen, vermischen mit was anderem kann. Bewusst dagegen arbeiten kann. Aber dann ist es immer auseinander. Ich kann natürlich auch im Vokal beim A, ich kann trotzdem eng werden. A, A, A, A. Ich mache es eng. A, A. Dann habe ich halt Verstopfung sozusagen. Ja, dann quetsche ich es heraus. Eigentlich will es so herausgehen. Ja, es ist allzu menschlich manchmal auch in der Sprache.
S und T haben etwas Kräftigendes. Im Sch liegt etwas Weiches 01:03:28
Staubend …
Staubend, rauschend, schäumend,
wälzt sich Wasserschwall,
rasch sich überschlagen,
schießt der Strom zu Tal.
Sprühend, spritzend, glitzernd,
zischt der Wasserfall.
Schau, durch Schlucht und Rauschen,
huscht ein Sonnenstrahl.
Genau, ein Sonnenstrahl. Schön aufmachen, dass es ganz weit wird. Wir müssen es nicht zu laut machen, dass es nicht zu angestrengt ist. Weil es ist immer die Gefahr, man kann natürlich, für eine große Bühne muss man dann auch Kraft darauf geben, aber da muss man schon sehr geübt sein, dass man eben nicht an Druck darauf gibt. Das sind wir einfach nicht gewohnt. So - Schweig … ist das? Schweig, schwöre …
Schweig, schwöre, schwinge,
schwerer, schweifender Schwan im Schwunge.
Schwerelos schwebe,
wie schwingende Schwalben.
So, jetzt wird es noch schärfer, also vom S und vom Sch. Im Sch war es etwas weicher eigentlich, bei dem Schweig, Schwöre, Schwinge, da kommt das W dazu, da kriegt es ein bisschen Wellencharakter, es ist aber sanfter irgendwo. Beim Schwan vielleicht ist es mächtiger, bei den Schwalben ist es sanfter irgendwo. Aber jetzt gehen wir zum S und SS jetzt wird es ganz scharf, zackig, zackig. Und da auch für die Bühnensprache - es sei dem Gefühl überlassen, ob man jetzt in vielen Bühnen würde man sagen, zackig. Also auf deutschen Bühnen oder auch Burgtheater ist genauso eine deutsche Bühne, wird zackig gesprochen. „Zackig, zornig zucken Blitze!" Wenn ich die Schärfe betonen will, kann ich aber ohne weiteres in dem Fall „zackig, zornig“ sagen. Dann unterstreicht es sogar dieses Eckige, Kantige noch mehr. „Zorni-ch” ist chchch - da kriegt es halt diese Aura, das Unscharfe herum. Zornig! Und das steht, zack, Ende. Keine Debatte mehr. Ich bin so zornig. Ich bin so zornig. Zornig! Puff! Kommt die Explosion und dann Schnitt. Also, frei nach Gefühl, da gibt es immer viel Variationsmöglichkeiten. Zackig, zornig …
Zackig, zornig, zucken Blitze
sausend, sausend rast der Sturm.
Suchend Plätze sich zum Zünden.
Plötzlich bläst Signal vom Turm.
Zischen, zündet's, grässlich rasseln,
peasselnd braust die Feuersbrunst.
Sängend, singend, erst verstummend,
wenn sich zeigt des Himmels Gunst.
So besessen, selbst vergessen,
löst sich Zorn in Asch und Dunst.
Genau, zum Schluss wird's ganz weich, irgendwo. Also man kann sehr stark variieren. Es ist ein Unterschied, ob es ein stimmhaftes S ist, oder ein stimmloses S. Also diese feinen Klangunterschiede mit denen, wenn man die deutlich hervorhebt, kann man spielen und es sehr viel bildhafter einfach machen. Dann wird der Inhalt nämlich zugleich Bild fürs Publikum. Und zwar nicht, aha, was hat er gesagt? Ah ja, so muss ich mir das vorstellen. Sondern es kommt schon sehr viel aus dem Erleben der Vokale und der Konsonanten. Das trägt zu dem Bild schon bei, das führt schon dorthin. Und da muss ich nicht jetzt nachdenken, um mir das nachträglich zu bauen, das Bild, sondern ich male mir innerlich das Bild schon im Klangerlebnis sozusagen mit. Und dann ist es viel eindringlicher und viel konkreter einfach irgendwo.
Der W-Spruch: Wind - Wasser - Welle. Meine Willenskraft begegnet einem Hindernis und überwindet es willig 01:08:14
So. W. Willig. Da ist wieder, kann man willig wellen, weil am Anfang fängt es sanft an. Das W. W. Nicht umsonst im Wort Welle. Das Gefühl haben dabei, da ist ein Widerstand, den ich überwinde. So entsteht die Welle. Der Wind kommt aufs Wasser, das Wasser leistet ihm aber Widerstand. Dadurch wird es aber durch die Kraft des Windes aufgebäumt. Es bäumt sich auf und fällt wieder runter. Dadurch entsteht die Welle. Also der Wind, der hineinfährt ins Wasser, Widerstand, aber der Wind ist stärker und bäumt es auf sozusagen, schäumt es auf, das Wasser. W. Das sollte man spüren, ein bisschen im W. drinnen. Meine Willenskraft begegnet einem Hindernis und überwindet es willig. Es fängt sanft an.
Willig Wellen, weiche Wogen,
wenn die wilden Winde wehen,
wuchtig wirkt und waltet Wille,
will in Wort und Werk bestehen.
Genau. Wird dann immer mächtiger. Es fängt sanft an.
Eine Landschaft, die zum Wiener Walzer inspiriert: Hügel, Straßen, alles schwingt, die Donau gibt den Klang dazu 01:09:40
Jetzt noch einmal das W. Und jetzt wird es wienerisch. Jetzt kommt der Walzer. Eins - zwei - drei! Noch immer mit dem W, das ist nämlich auch drinnen. Walzer …
Willst du im Walzer schwingen,
ewige Wonnen gewinnen?
Walle, Wanderer nach Wien,
wo Wege durch Weinland schwingen.
Wald und Wiesen im Winde,
Wellen und Wogen und Singen.
Wanderer, wer wienwärts fährt,
Wein, Weib und Walzer beschwört.
Genau, da haben wir es ein bisschen im Rhythmus auch drinnen, das Schwingen … und es ist kein Wunder, dass der Walzer in Wien entstanden ist. Für mich war das immer ein riesiges Erlebnis, wenn man vom Weinviertel runterkommt Richtung Donau und zu merken, wie die ganze Landschaft Walzer schwingt. Und unten die Donau, die schwingt. Das ist eigentlich die Donau, die den Klang angibt. Aber der ganze Hügel, die Straßen, das alles schwingt mit … dieses leichte Gewellte überall drinnen. Du fährst da so in den Kurven, in den Serpentinen runter und das ist Walzer. Die ganze Landschaft tanzt Walzer. Die Höhenstraße. Ja, ja, ja, absolut. Absolut. Das ist kein Zufall, dass es hier entstanden ist. In anderen Ländern ist wieder eine andere Charakteristik und die lebt dann auch in der Musik drin. Das ist nicht willkürlich einfach. Das ist ein Aufnehmen der Stimmung, die in der Natur drinnen ist. Ein unbewusstes, bewusstes oder mehr unbewusstes Wahrnehmen, was da in der Natur lebt. Und das wirkt inspirierend. Daher kommt die Inspiration. Die ist überall da eigentlich. Ich muss sie nur erleben können. Wenn ich anfange mit zu tanzen, mit der Landschaft sozusagen, innerlich mit zu tanzen und komponieren kann, dann kommt das fast von selber hinein. Das brauche ich nur miterleben. Das ist so stark. Also die Inspiration kommt nicht irgendwo aus dem pff- weiß ich nicht wo, sondern ganz konkret auch aus der Landschaft zum Beispiel. Das ist drinnen.
F und T erzeugen Bewegung 01:12:15
So, was haben wir jetzt? Pegasus. Pegasus, ja, Fesseln springen. Ohne Brille sehe ich schon nichts mehr. Fesseln … Jetzt haben wir das FFF. Also da ist jetzt wirklich Luft. F. Nicht einfach ausströmen lassen, sondern wirklich hinaus blasen … kräftig.
Fesseln sprengt das Flügelpferd,
feurig saust die Luft,
fasst den Zaun mit fester Faust.
Auf! Die Freiheit ruft.
Genau! Mit dem T schlägt es dann ein: Ruft! Durchs Enge … in die Ferne - t- schlägt es noch ein. Ruft … Also ich erreiche die da draußen. Die Freiheit ruft! Die Bewegung drinnen spüren, auch im Satzbau, in der Entwicklung. Das ist das Geniale an diesen Sprücherln, dass diese Bewegungen, diese unterschiedlichen Bewegungen drinnen sind. Da geht es nicht … was meint er denn mit dem Inhalt alles? Das ist Bild. Bild, in dem sich die einzelnen Konsonanten manifestieren können. In verschiedensten Variationen. Das ist das Eigentliche, um das es geht.
Im B-Laut spüren wir die Bildekräfte der Natur 01:13:37
So alt wie Berge. Genau, Berge. Wenn wir sprechen, machen wir ein bisschen Hamster-Backerl [österr. für dicke Wangen]. Naja, Ball. Baum. Das Wort Baum. Baum kann kein Tannenbaum sein, vom Bild her. Das ist einer mit einer sehr buschigen Krone. Tree ist schon was anderes, das ist schon eher irgend so was … so scharfe Äste und so ein Ding. Aber Baum oder Berg oder Blume, wenn sie aufblüht macht sie auch so ein B. Oder eine Blase macht auch Bluppp, blupp. Das ist die Gestaltungskraft drinnen. Und die kann ich lebendig machen. Wenn ich es so erzähle, wenn ich es selber erlebt, dann wird es für den Zuhörer lebendig. Wenn ich sage: „Berge, Bergen, bunte Habe unter Bäumen, Bächen, Blumen, Leben, Alben haben Gaben”, dann kriege ich gar nichts mit. Denke ich mir brrr- komischer Text. Versuchen wir es. Also richtig, fangen wir mit mächtigen Bergen an und dann gibt es kleinere Varianten auch.
Berge bergen bunte Habe
unter Bäumen, Bächen, Blumen,
leben Alben, haben Gaben,
Baum, Basalt und Kupfertempel,
grippen, krabbeln, scheppern, schleppen,
Blei und Silber über Treppen.
Genau, hartes P eben dann auch drin beim P. Wie soll ich sagen? Blase. Und wenn die Blase platzt, dann ist das harte P. Darum ist der Bach auch durchaus gerechtfertigt. Da blubbert etwas vor sich hin. Also kein reißender Strom, der da runter geht, sondern so gemütlich. Da blubbert etwas. Das liegt als Bild drin. Das kann ich verwenden, um das anschaulich dem Publikum nahe zu bringen. Oder um wirklich in der Natur diese Bildekräfte zu erleben, ganz konkret, die auch in der Sprache leben. Das heißt, wir haben das in unserer Sprache drinnen.
Natürlich kann wer sagen, wie ist das im Französischen, im Englischen und so weiter? Ist eine etwas andere Perspektive darauf, aber überall findet man Zusammenhänge. Es ist nicht willkürlich. Vor allem das Wichtigste ist, selber wach werden, aufmerksam werden, weil man darf selber erleben. Und das Erleben hat immer Recht. Wenn ich es erleben kann, nacherleben kann, habe ich meine individuelle Perspektive darauf. Aber wenn ich mich verbinde mit der Sache, dann habe ich einen wahren Aspekt, eine wahre Perspektive darauf. Das kann ich auch anders … unter einem anderen Gesichtspunkt anschauen, ohne weiteres. Aber wichtig ist, dass ich mich verbinde innerlich. Und dann komme ich eben über diese Kluft hinweg, aha, da ist die Natur draußen, da bin ich und eigentlich - pff - wir sind völlig getrennt voneinander. Ich tauche ein. Dann tauche ich in das Leben der Natur ein. Eben auch der Bach lebt, wenn er blubbert. Und wenn er nur mehr stinkende Blasen macht, dann ist schon was anderes. Dann sind es Gärgase.
Das Wort „Mut“: Bei „mir “sein (M), ich nehme mich zusammen (U), fest und aufrecht am Boden stehen (T) 01:17:33
So. Lot. Mächt. M. M. M. Wunderschön. Versucht es im Wort Mut, das Wort Mut liebe ich. M … ist, wann mache ich denn mhh? Wenn mir was schmeckt. Genau. Das heißt, ich will mir das einverleiben. Weil es gehört nämlich „mir” im übertragenen Sinn. Mein. Es ist „mein”. Ich will es in irgendeiner Form zu mir nehmen, etwas ergreifen wollen, zu mir nehmen wollen. Mmhh! Und vielleicht schmeckt es auch gut, aber in jeder Form. U, das Wort Mut jetzt, ich nehme mich zusammen, stelle mich eng, wie ein … weiß ich nicht, Wehrturm her, und stelle mich fest dabei auf den Boden. T ist nämlich, das fest sich hinstellen, unter anderem. T, Tisch, Tafel, das steht, das rührt sich nimmer. Also ich nehme mich zusammen, mache mich wehrhaft und bin standfest. Das ist das Bild hinter dem Wort Mut. Nicht bloß ein abstrakter Begriff, sondern ein ganz konkretes Erlebnis. Kann in anderen Sprachen anders ausgedrückt werden, aber da steckt letztlich dieses Grunderlebnis dahinter. Dieses sich zusammennehmen, bei mir sein, mich aufrecht eng hinzustellen und fest hinzustellen. Das ist das Wort Mut. Es ist nichts Zufälliges, man kann bei allem mehr erleben.
Es ist nicht einfach, ja, könnte ja anders genauso heißen. Ja, aber dann ist ein anderes Erleben dahinter. Kann ja sein. Aber ich kann ein konkretes Erleben, den Grundtenor des Erlebens herausfinden und dann immer noch in allen individuellen Variationen es erleben. Das ist das Wichtige, um das es bei der Sprachgestaltung geht, zu diesem Erleben zu kommen. So, mächtig. Da ist mächti-ch … würde ich -ch sprechen, aber überlasse ich euch, wie ihr es erlebt.
Mächtig schlummert Mut in mir,
meiner Meinung Maß bestimmen
muss er,
hemmt in Menschenmacht,
macht er immer mich ergrimmen.
Genau. Das ist eben das Geniale an den Sprücherln, dass man so viel Doppel-M zum Beispiel drin … das T kommt immer wieder vor, das die sich Hinstellen. Der U ist immer wieder mal drinnen. Das gibt dem so einen kompakten Bau. Also, dass dieses Erleben gestärkt wird dadurch. Also, das ist nicht vom Kopf, das ist vom Erleben gestaltet.
Was dem Wort den Sinn gibt, gibt auch der Welt ihren Sinn, der sich sichtbar in den Formen der Natur ausdrückt 01:20:29
Weil man kann sich denken, was sollen die komischen Sprücherln und welche Bedeutung haben die? Kinderreime, oder was soll's sein? Nein, es ist ein konkretes Erleben, das den Laut in verschiedensten … aus verschiedensten Perspektiven versucht zu zeigen, wie es spielt es mit anderen Lauten. Für das wach werden. Und man glaubt es gar nicht. Es geht dann wirklich, sich selber so zuzuhören, was erlebe ich denn eigentlich bei dem, was ich da spreche. Nicht nur ich sage es, weil ich weiß es, jetzt sage ich es auch, sondern ich erlebe eine ganze Welt dabei. Da fahren mich überall blinkt was auf und schreit einem an. Und das ist zum Beispiel dann die Elementarwesenwelt, die überall sagt - hallo, da bin ich, in Wahrheit.
Und eben das Verständnis „Am Anfang war das Wort”. Die Welt ist aus dem Wort geschaffen. Das ist halt im Großen diese formende Kraft, die drinnen ist. Das ist vor allem im Konsonantischen drinnen. Was dem Wort den Sinn gibt, gibt auch der Welt ihren Sinn, der sich sichtbar in den Formen der Natur ausdrückt. Das ist drinnen. Darum, der Faust, durch den Mephisto verirrt, will das alles anders übersetzen. Und bleibt nicht dort, dass am Anfang war das Wort. Das ist ihm zu wenig. Wie soll die Welt aus dem Wort geschaffen sein? Blödsinn. Ja dann erlebt er diese Kräfte nicht. Er muss mehr Kraft und was weiß ich alles drinnen haben. Der Sinn muss es sein und so weiter. Dann wird es ganz intellektuell. Aus dem ist die Welt sicher nicht geschaffen. Kein Weltenbaumeister ist jetzt in irgendeinem himmlischen Büro gesessen und hat das designt, die Welt dort.
Da sieht man schon, wie verrückt das ist, wenn da manche vom göttlichen Design sprechen oder so. In Amerika gibt es ja da genug, die da … weil sie halt gegen die materialistische Evolutionslehre sind, aber jetzt sprechen sie vom Design, das drinnen ist. Das ist ganz anders. Das ist etwas Wesenhaftes. Da sind so viele Wesen drinnen, die sich eben auch im Wort ausdrücken, aber genauso in den Formen der Natur. Und in all dem lebt das Göttliche, das in uns aber auch lebt und in uns halt zur hörbaren Sprache wird. Draußen ist es im Grunde die sichtbar gewordene Sprache, in den Formen der Natur. Und in den Krängen dann natürlich auch, also das Seelische mehr wiedergeben.
Im N liegt Verneinung und Abgrenzung, im L eine sanfte Beweglichkeit und rhythmisches Schaukeln 01:23:19
So. Verneinen. Ja, das ist wichtig. Verneinen muss man auch können. Das M ist so ein bisschen hm, merkt man. M, M, M. Da drücke ich es ein bisschen. Nein! Nicht! Ich setze mich ab, während das M, ich verbinde mich eigentlich oder nehme es zu mir. N. Nein. Verneinen.
Verneinen muss man können.
Nichtsnutziges beim Namen nennen.
Das eigene Innere nie verkennen.
Ob Niedrigkeit in Zorn entbrennen.
Na, wieder die Verstärkung durch die Doppel-N drinnen. Wichtig für das Übungssprücherl, die Doppel-N noch einmal verstärken. So, jetzt die zarte Variante, das L. L, L, was machen wir? L, hm, hm. Was braucht man da vorhin? Hm, hm, das ist die Zunge. Die Zunge muss beweglich sein. Auch wieder, um beim Wienerischen zu bleiben, beim Meidlinger L. Das ist … heute ist das nicht mehr so, weil die Bezirke schon alle sehr gemischt sind. Aber es war mal sehr ausgeprägt, dass halt die schwere Zunge drinnen ist. Also dieses Meidlinger L. Lili lale lieblich, lola lale fein, lullt mein kleines Engerl, lullt mein Alles ein. Oh, oh, die Zunge ist einfach nicht beweglich, ist nicht sanguinisch genug, um feine Töne … also sie ist schwer, es unterliegt der Schwerkraft einfach sehr stark. Das wollen wir also eher nicht machen, sondern wir wollen bewegt werden, aber hier ganz sanft. Es soll so sanft sein, man stelle sich vor, ein Kindlein liegt in der Wiege und man schaukelt es ganz sanft, dass es einschläft. Da muss es immer sanfter werden. Also:
Lili lale lieblich, lola lale fein,
Lullt mein kleines Engerl,
lullt mein Alles ein.
Genau. Immer langsamer werden. Und den Rhythmus, das Schaukeln, dass es ja kein hektisches Schaukeln wird, sondern immer sanfter wird. Immer sanfter, bis ich loslassen kann und es schläft. Immer mehr zurücknehmen, das heißt, fangt es noch ein bisschen kräftiger an, aber dann wird es immer sanfter, immer gedehnter irgendwo. Schön achten, dass der Rhythmus durchschwingt. Dass das ganz gleichmäßig ist, weil einmal ein bisschen Rucker drinnen und - Aaah, ääah, ist es schon wieder munter. Nein, lassen wir es gut sein. Oder wollt ihr es noch einmal machen? Ja. Gut. Also. Ganz sanft.
Lili lale lieblich, lola lale fein,
Lullt mein kleines Engerl,
lullt mein Alles ein.
Stellt euch vor, so ein Sprücherl - man ist gerade total im Zorn, man ärgert sich über etwas. Und jetzt macht das Sprücherl. Und so, dass es wirklich ganz sanft wird. Das ist weg! Der Zorn geht jedenfalls nicht mehr mit dir durch. Du kannst es selber runterfahren. Einfach bewusst sagen, so, jetzt mache ich das Sprücherl, gehe ganz ins Sanfte, obwohl ich innerlich tobe. Ich meine, es ist ja manchmal gut, das auch toben zu lassen, aber wichtig ist ja immer, dass man es selber im Griff hat, nicht Sklave der Sachen ist es, dass man es sich auch rausnehmen kann. Und da kann sowas durchaus helfen. Das ist jetzt nicht Nebenübungen, aber es verwandt damit irgendwo.
Wunderbares Wort „Licht”, mit dem Ich drinnen. Das ist das Leben selbst, das sich manifestiert in der aufrechten Haltung, im Atem, und dann fest aufrecht auf der Erde steht. Aus dem Licht geboren 01:27:37
Gut. Aus der Quelle. Noch einmal. Das L. Dieses ganz lebendig, leichte, bewegliche, das L. Und vom Tempo her groß, wenn es dann die Wellen fangen ganz klein an. Sie sind auch im Licht irgendwo drin. Licht, wunderbares Wort. Leben im L. L ist eigentlich sehr lebendig. Es ist immer beweglich. Und das Wort Licht, zum Beispiel Leben, Ich, dann ist das Ich drinnen, da ist das Licht drinnen, da ist der Atem drinnen, und dann T - steht es aber da. Wunderbares Wort, das Wort Licht! Das ist das Leben selbst, das sich manifestiert in der aufrechten Haltung, im Atem, und dann fest aufrecht auf der Erde steht. Aus dem Licht geboren.
Es kann mir … so ein Blödsinn, was du sagst! Ja, wenn man es erleben kann, dann steckt was Wahres drin. Wenn ich das erleben kann, ist es richtig einfach. Wenn ich das Leben erleben kann in dem, wenn ich das spüre in der Haltung, spüre den Atem dabei, und wie ich sicher stehe auf der Erde, dann ist das … [ein Geräusch von außen] … gut, das war was anderes, draußen. Dann wird das Wirklichkeit. Dann verwirkliche ich das drinnen. Also, da braucht man nicht jetzt naturwissenschaftliche Studien oder was darüber machen, sondern die Wahrheit des Erlebens. Das ist wichtig dabei.
Und es wird hier immer größer, dann die Wellen, die da angedeutet werden, werden bis zu den großen Meereswellen …und da stellen wich mir immer vor, so 30 Meter Wellen. Also wirklich, am Ozean draußen, Hochsee, 30 Meter Wellen, die können schon entstehen. Die haben aber ein anderes Tempo, das ist nicht wie bei einem Bach … wo dann fällt die ganze Schwere wieder hinunter. Also das hat einen ganz anderen Rhythmus, das heißt, es wird dort ganz breit, ganz breit und mächtig. Das hat eine ganz andere Zeitphase drinnen, viel länger einfach, dass es sich auftürmen kann. Das versuchen wir zu erleben drinnen:
Aus der Quelle laufe schnelle,
lispelnd, lallend, quellend, schwellend,
Well auf Welle.
Gleich dem Leben,
gleich des Lichtes voller Helle,
wie der Liebe stiller Fülle.
Eilt zum Flusse,
fällt zu Tale,
grollend rollend,
sprudelnd labt sie
Land und Leute,
will ins volle Meer zerfließen.
Well an Welle, waldgewaltig,
löst sich schließlich,
quillt als Wolke auf ins All.
Schön, das Wort All - ah, ganz ins Weite gehen und alles erfüllt von Leben und Licht. All. Wunderbares Wort. Das Erleben dabei. Es braucht nicht noch einen wissenschaftlichen Beweis dafür. Wenn ich es erlebe, dann kann ich den Kosmos ebenso erleben. Und diese Bedeutung drinnen spüren einfach. Wenn ich es nicht erlebe, dann abstrakt wäre ich auf das nie gekommen. Aber so kann ich mich verbinden und ich spüre das Leben überall, das drinnen ist. Im Ganzen, Großen. Und wie das Ganze zusammenkehrt, dass da im Kleinen es auch kommen kann. Das sind die Schritte halt, die auch zu den sogenannten höheren Wahrnehmungen führen. Aber es ist eigentlich keine Hexerei, weil wir erleben es zum Beispiel in der Sprache drinnen. Da ist alles irgendwo versteckt schon drinnen. Wir brauchen es nur heben. Und dann kann ich es an den Naturformen, am Naturgeschehen miterleben. In uns erlebt sich die Natur. Die Welle draußen erlebt nichts. Die erlebt nicht das, was wir sprechen. Sie tut es.
Aber das ist das Heilsame für die Natur, für die ganzen Elementarwesen, die damit verbunden sind, dass wir es erleben und ihnen das entgegentragen im Grunde. Weil sie lesen in unserer Seele sozusagen. Das spüren sie. Und sie sehen sich gespiegelt drin, sie sehen sich wahrgenommen, wenn man so will. Aber dazu muss ich es eben wirklich erleben können.
Im R spiegelt sich die kosmische Drehbewegung wieder 01:32:55
Gut. Starken Armen. Das R hat man ganz stark gerollt. Heute ist es besser, es nicht zu stark zu machen. Vor allem nicht am Ende irgendwo schauen, wo ist es. Ich kann es vorne sprechen. Ich kann es ganz im Rachen sprechen oder ich kann es irgendwo dazwischen haben. Also probieren wir es einfach einmal, wie es geht. Es ist auf jeden Fall im R drinnen eine sehr starke Kraft. Und zwar so eine Art drehende Bewegung. Rrrrrr. Triebhaft auch. Wir zeichnen es jetzt bewusster. Also die Energie zu spüren, die drinnen ist.
Starken Armen Ruhm und Ehre,
Arbeit rasch den Reichtum mehre,
rascher rollen Räder,
schnurren, knarren, brummen, surren,
ärgern lärmend arme Ohren,
drehn und drohen im Hirn der Toren,
Groschen rollen reich zur Truhe,
Herr der Erde, raste, ruhe!
Ja, das ganze Drehbewegung, das ganze Planetensystem, das sich dreht, ist da drinnen in dem Laut R. Das kleine Abbild davon, das ist das Weltenwort. Das Weltenwort ist draußen, wenn ich die Planetenbewegungen mal anschaue. Da dreht sich alles, diese Drehbewegung drinnen. Und im Kleinen machen wir das nach. Das ist das Zeichen, dass als diese Laute entstanden sind, ein mehr unterbewusstes, aber doch ein Miterleben dieser Bewegungen war. Aus dem formt sich das. Das ist ja nicht fertig mit der Geburt, sondern es muss durch die eigene Tätigkeit ergriffen werden. Und das ist eben beim Kind durch die Nachahmung, durch das Hören, sich hineinleben in den Laut. Das ist die gewaltige Leistung, die das Kind macht, oder eine der ganz gewaltigen Leistungen. Und da ist aber das ganze Weltgeschehen … liegt drinnen, indem es einfach nur schon die Laute lernt. Gut, jetzt sind wir bald durch. Schauen, was kommt denn als nächstes. Trompeten, Trem. Ah, Trem. Gut, noch einmal das R sehr stark in Verbindung mit dem T. Es fängt ziemlich rhythmisch an, der Schluss ist dann nicht mehr so rhythmisch.
Trem, Trem, Trem, Te-Te,
im Schritt und Tritt ich heimwärts geh.
Trum, Trum, Trum-Tum-Tum,
die Trommel brummet schrumm-bumm-bumm.
Froh und frei ertönt es da,
Trompeten schmettern laut, Trara!
Genau, einfach Lust daran haben, das zum Klingen zu bringen.
G- und K sind von allen Konsonanten die stärksten Willenslaute 01:36:14
Grau und groß, jetzt geht es um G und K. Das sind die stärksten Willenslaute von den Konsonanten her. G, G, Gebirge, G. Das G ist ein ziemlicher Druck, das steckt ziemlich im Wachen, das ist nicht vorne. Wie andere Laute, das L z.B. ist in der Mitte. Das L, was wir vorher hatten, ist die bewegliche Zunge, beim R auch bis zu einem gewissen Grad. Das sind eh die einzigen. Aber es sind z.B. auch die Laute, wie das T, was vorne an den Zähnen sitzt. Die sind viel stärker vorne, viel stärker mit dem Bewusstsein verbunden. Die Laute, die Konsonanten, die weiter hinten sitzen, haben viel mehr mit dem Willen zu tun. Und was dazwischen ist, ist das Gefühl. Also im L ist z.B. auch sehr viel Gefühl drin, das ist die Zunge drinnen, die beweglich ist. Und wenn ich daher L locker, es ist alles so locker, Leute. Aber wirklich so tiefes Gefühl drückt sich in der Sprache dann nicht aus. Sondern in der Beweglichkeit. Da lebt es dann. Gut. Grau:
Grau und groß durch Wolken drängend,
ragt Granit in Bergesluft.
Kräftig streckt sich, knochig, eckig,
kalt durch Kanten, Gruft und Schluft.
Größer ragt noch, Gotts begnadet,
Geist, der drängt zur Künstlerschaft.
Keck und kühl erkämpft Erkenntnis,
ringende Gedankenkraft.
Dieses raaagt - ganz langes A. Dann wird es so ein riesiger Berg, ein riesiges Gebirge. Grau und groß durch Wolken drängend, ragt Granit in Bergesluft. Aha, jo, jo, eh. Ragt. Geh mit. Mount Everest. Der hat schon eine gewisse Höhe. Also mit sowas kann man spielen einfach, dass man es einfach dehnt dann ein bisschen. Und es wirkt, wenn man es gekonnt macht, nicht gekünstelt. Das sind so die Feinheiten, die drinnen sind. So, jetzt haben wir eigentlich nur mehr so Spielereien. Am Jangtsekiang. Das J und das NG, das ist eigentlich fast zwischen Vokal und Konsonant im Grunde. Das ist eigentlich ein eigener Laut. Das ist es auch in vielen Sprachen. Einfache Spielerei:
Am Jangtsekiang
ein Chinese sang.
Ching Chang Chunken,
es sangen Chinas Unken.
Ching Chung Chanken,
die Chunken Chinas sanken.
Genau. Einfach a Hetz!
Abschluss mit Eichen- und Birken-Sprüchen 01:39:33
Ja, wollt ihr noch die zwei machen? Dann würden wir Schluss machen. Das wäre der Abschluss. Jetzt sind noch die Eichen als ganz was Kräftiges. Und dann die zarten Birken. Also, genau. Das erste Wort:
Knarrend, knurrend, knorrige Eichen,
wollen wütendem Wind nicht weichen,
greifen mit Armen, Kräfte strotzend,
sausend, sausenden, stürmend, rotzend,
Wurzeln in Klüften, im Erdkern gründend,
Größe und Tiefe in sich verbindend,
saftiger Kern im trockenen Korke,
Stahl im Blut unter rostbrauner Borke,
ganz Charakter und dir zum Zeichen,
knarrend, knurrend, knorrige Eichen.
Genau. Diese Kraft, die drinnen ist. Jetzt was ganz Lichtes, Zartes, Sanftes:
Weiblich, schmiegsam, biegsam, fügsam,
lispeln Birken, hell belaubt,
lassen durch des Windes Lüfte,
wenn er sie zu fassen glaubt.
Denn wie Kupfer, Licht durchleitend,
Grünspahn leuchtend, zart im Lenz,
goldgelb herbstlich, immer weißlich,
Licht und Luft ist hier Tendenz.
Atmend aus die Bodenfeuchte,
Schwestern im Verein gesellt,
saugt die Birke, Schönheit leuchtend,
jüngferlich und zart besehn.
Schön. Klingt sehr harmonisch aus.
Eine Einladung zum spielerischen Üben 01:41:41
Ja, ich denke, damit lassen wir es für heute gut sein. Es ist ja eine Einführung, wie man mit den Vokalen, mit den Konsonanten spielerisch erlebend umgehen kann. Selber gestalten damit, spielen mit diesen Dingen. Wie kann ich sie nützen, wenn ich die Dichterin zitiere, wenn ich im Alltag vielleicht auch spreche, bei einem Vortrag spreche oder eine Rolle spiele. Wie gehe ich um? Welche Nuancen kann ich den Lauten mitgeben? Um das deutlicher zum Ausdruck bringen, was in mir selber oder in der Rollenfigur vorgeht. Um das geht es dabei.
Und die weiteren Übungen, die wir vielleicht irgendwann ein anderes Mal ja gerne machen können, ist, welche Bedeutung haben die Rhythmen, die Versmaße und so. Wo kommt das her? Die Versfüße aus dem rhythmischen Schreiten eigentlich, wo kommt das her? Also Rhythmus. Und Rhythmus ins Leben zu bringen, ist gar nicht so schlecht. Daher ist einmal auch rhythmisches Sprechen auch eine gute Übung für einen selber, diesen Rhythmus in sich zu erleben, zu variieren. Rhythmus heißt aber mal schneller, mal langsamer. Nicht toter Takt, immer gleich, sondern beweglich drinnen werden.
Und dann kann man später weitergehen zu Temperamenten und dergleichen. Da kann man noch viel färben. Wie schaut es aus, wenn ich den selben Text sanguinisch, luftig, leicht mache? Oder wenn ich ihn cholerisch mache? Oder wenn ich ihn tragisch als Melancholiker nehme? Oder als Phlegmatiker einfach entspannt zuschaue, dabei im Grunde. Aha, mein Haus stürzt jetzt ein. Naja, eigentlich wollte ich eh schon ein neues haben. Die Versicherung zahlt's eh. Da kann man schon viel nehmen. Wir haben alle, jeder alle vier Temperamente, aber das hilft einem schon viel, mehr Ausdruck zu kriegen und die Einseitigkeiten vielleicht auch des eigenen Temperaments zu überwinden. Weil Temperament heißt Mischung und im Idealfall haben wir alle vier Grundtypen zur Verfügung. Eigentlich bin ich melancholisch veranlagt, aber ich kann einmal auch sanguinisch vielleicht werden. Wäre ja nicht schlecht, wenn ich mich selber herausreißen kann. Das lernt man dabei. Ja, das sind so einfache Einblicke einmal und einfache Grundübungen für die Sprachgestaltung. Wichtig ist, wenn man sich dem nähern will, üben, tun, Freude haben dran, mit Freude. Und spielerisch tun, experimentieren damit, es ist alles erlaubt. Einfach voll als Mensch drinnen stehen.
In diesem Sinne. Danke! Gut, machen wir Schluss. Jetzt haben wir uns eine Pause verdient. Danke euch! Ihr habt so großartig mitgemacht!
Glossar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar A
A
- „[…] mit dem Atem hängt sehr stark das Seelische, das Gefühl auch zusammen. Merkt man ja, wenn man Atembeklemmung hat, kriegt man sofort Angst […] mit jeder Gefühlsstimmung, die ich habe, ändert sich etwas im Atem auch drinnen.“ | Peter, W. Sprachgestaltung, 2025, 00:34:44
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar B
B
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar C
C
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar D
D
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar E
E
- „[…] das ist das Heilsame für die Natur, für die ganzen Elementarwesen, die damit verbunden sind, dass wir es erleben und ihnen das entgegentragen im Grunde. Weil sie lesen in unserer Seele sozusagen. […] Sie sehen sich wahrgenommen […]” | Peter, W. Sprachgestaltung, 2025, 01:27:37
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar F
F
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar G
G
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar H
H
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar I
I
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar J
J
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar K
K
Konsonant
- „[…] die Seelenstimmung eigentlich, die drinnen ist, die Emotion […]die wird vor allem über die Vokale transportiert. […] Die Konsonanten geben Formen […] zieht Atemluft nach außen.” | Peter, W. Sprachgestaltung, 2025, 00:06:21
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar L
L
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar M
M
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar N
N
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar O
O
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar P
P
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar Q
Q
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar R
R
- „[…] wir arbeiten mit den Übungssprüchen, die Dr. Karl Rössel-Majdan verfasst hat, mit denen ich selbst vor 40 Jahren begonnen habe zu arbeiten.” | Peter, W. Sprachgestaltung, 2025, 00:00:28
- „Dann fange ich an zu verstehen, wie ein Rudolf Steiner von Wasserwesen, Undinen sprechen kann. […] Undinen sind eine Realität, aber das sind nicht irgendwelche unsichtbaren Geister, die da herumschwirren. Das ist […] ein ganz konkretes seelisches Erleben.“ | Peter, W. Sprachgestaltung, 2025, 00:59:44
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar S
S
- „[…] mit dem Atem hängt sehr stark das Seelische, das Gefühl auch zusammen. Merkt man ja, wenn man Atembeklemmung hat, kriegt man sofort Angst […] mit jeder Gefühlsstimmung, die ich habe, ändert sich etwas im Atem auch drinnen.“ | Peter, W. Sprachgestaltung, 2025, 00:34:44
- „[…] wir arbeiten mit den Übungssprüchen, die Dr. Karl Rössel-Majdan verfasst hat, mit denen ich selbst vor 40 Jahren begonnen habe zu arbeiten.” | Peter, W. Sprachgestaltung, 2025, 00:00:28
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar T
T
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar U
U
- „Dann fange ich an zu verstehen, wie ein Rudolf Steiner von Wasserwesen, Undinen sprechen kann. […] Undinen sind eine Realität, aber das sind nicht irgendwelche unsichtbaren Geister, die da herumschwirren. Das ist […] ein ganz konkretes seelisches Erleben.“ | Peter, W. Sprachgestaltung, 2025, 00:59:44
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar V
V
- „[…] die Seelenstimmung eigentlich, die drinnen ist, die Emotion […]die wird vor allem über die Vokale transportiert. […] Die Konsonanten geben Formen […] zieht Atemluft nach außen.” | Peter, W. Sprachgestaltung, 2025, 00:06:21
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar W
W
- Das Weltenwort ist draußen, wenn ich die Planetenbewegungen mal anschaue […] Und im Kleinen machen wir das nach. | Peter, W. Sprachgestaltung, 2025, 01:32:55
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar X
X
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar Y
Y
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar Z
Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9 | Gesamtglossar 0-9
0-9